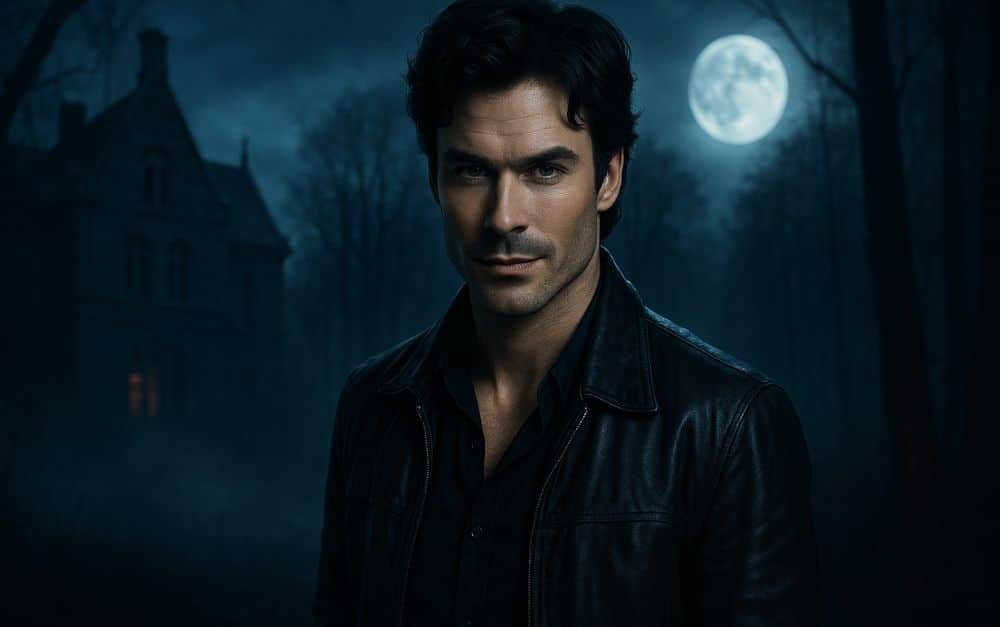Immer wieder heißt es „Geht wählen!“. Doch nicht jede Person in Deutschland darf tatsächlich an die Urne. Menschen mit geistigen Behinderungen sind nach aktueller Rechtslage teilweise vom Wahlrecht ausgeschlossen. Und auch Kinder haben kein Stimmrecht. Die Diskussion dreht sich also um eine zentrale Frage: Wenn alle Menschen gleichberechtigt sein sollen – warum gilt das nicht auch beim Wahlrecht?
1. Grundgesetz und Paragraph 13
Artikel 3 Absatz 3 des Grundgesetzes erklärt klar: Niemand darf wegen einer Behinderung benachteiligt werden. Trotzdem dürfen rund 85.000 Menschen mit geistiger Behinderung nicht wählen. Grund ist Paragraph 13 des Bundeswahlgesetzes, der vorsieht: Wer für sämtliche Angelegenheiten eine rechtliche Betreuung benötigt, verliert automatisch sein Wahlrecht. Über diesen Ausschluss entscheidet ein Gericht. Kritiker sehen darin einen offensichtlichen Widerspruch zum Gleichbehandlungsgebot des Grundgesetzes.
Internationale Gremien wie der UN-Ausschuss für die Rechte von Menschen mit Behinderungen haben Deutschland dafür gerügt. Auch viele Parteien haben angekündigt, den Paragraphen abzuschaffen – umgesetzt wurde das bisher jedoch nicht. Politische Uneinigkeit, etwa bei Fragen zu Überhangmandaten, bremste die Reformen. Hoffnung gibt es aber: Mehrere Betroffene klagen vor dem Bundesverfassungsgericht. In manchen Bundesländern wie Schleswig-Holstein oder Nordrhein-Westfalen ist der Ausschluss bereits aufgehoben.
2. Kompetenz als Voraussetzung?
Befürworter des Ausschlusses argumentieren, dass nur Menschen wählen sollten, die selbstständig politische Urteile treffen können. Wer in allen Lebensbereichen auf Unterstützung angewiesen ist, sei dazu nicht in der Lage.
Kritiker halten dagegen: Politisches Wissen ist nicht nur bei Menschen mit Behinderung unterschiedlich ausgeprägt – auch viele andere Wahlberechtigte haben nur wenig Ahnung von Politik. Gleichzeitig gibt es viele Menschen mit Behinderung, die politisch interessiert und urteilsfähig sind. Warum sollten diese ausgeschlossen werden, während andere, weniger informierte Bürger wählen dürfen?
3. Wahlrecht ab Geburt?
Wer Gleichberechtigung wirklich konsequent denkt, muss auch die Frage stellen: Warum sind Kinder vom Wahlrecht ausgeschlossen?
Auch Minderjährigen wird mangelnde Kompetenz und leichte Beeinflussbarkeit vorgeworfen. Damit wiederholen sich dieselben Argumente wie bei geistig behinderten Menschen. Ein Wahlrecht ab Geburt erscheint derzeit utopisch – doch es wäre die logische Fortführung der Gleichberechtigungsdebatte.
Ein praktisches Modell könnte darin bestehen, dass sich Kinder selbst registrieren müssen, sobald sie am politischen Prozess teilnehmen wollen – ganz ohne Altersgrenze. So würden nur die mitmachen, die tatsächlich Interesse zeigen. Um Einflussnahme zu reduzieren, ließe sich die Briefwahl für Jüngere einschränken. Ganz verhindern lässt sich Manipulation allerdings bei niemandem – unabhängig vom Alter.
4. U-18-Wahlen als Einblick
Ein Blick auf die U-18-Wahlen zeigt, wie sich Kinder und Jugendliche entscheiden würden: Hier schneiden CDU und CSU zwar ebenfalls am besten ab, allerdings deutlich schwächer als bei den Erwachsenen. Die Grünen erreichen höhere Werte, und auch kleinere Parteien wie die Tierschutzpartei erzielen beachtliche Ergebnisse. Vom Rechtsruck, der Teile der Gesellschaft prägt, ist bei den Jugendlichen wenig zu sehen. Das verdeutlicht: Ein Wahlrecht für Kinder würde das politische Kräfteverhältnis spürbar verändern.
5. Ausblick und Fazit
Wenn 2021 der Bundestag neu gewählt wird, könnten erstmals auch Menschen mit geistiger Behinderung mitwählen – vorausgesetzt, Paragraph 13 wird abgeschafft oder das Bundesverfassungsgericht erklärt ihn für unvereinbar mit dem Grundgesetz. Das Wahlrecht ab Geburt bleibt zwar eine ferne Vision, doch die Debatte macht deutlich: Gleichberechtigung darf nicht an Alters- oder Kompetenzgrenzen enden. Der Weg zu mehr Teilhabe ist noch lang – aber die Diskussion ist eröffnet.