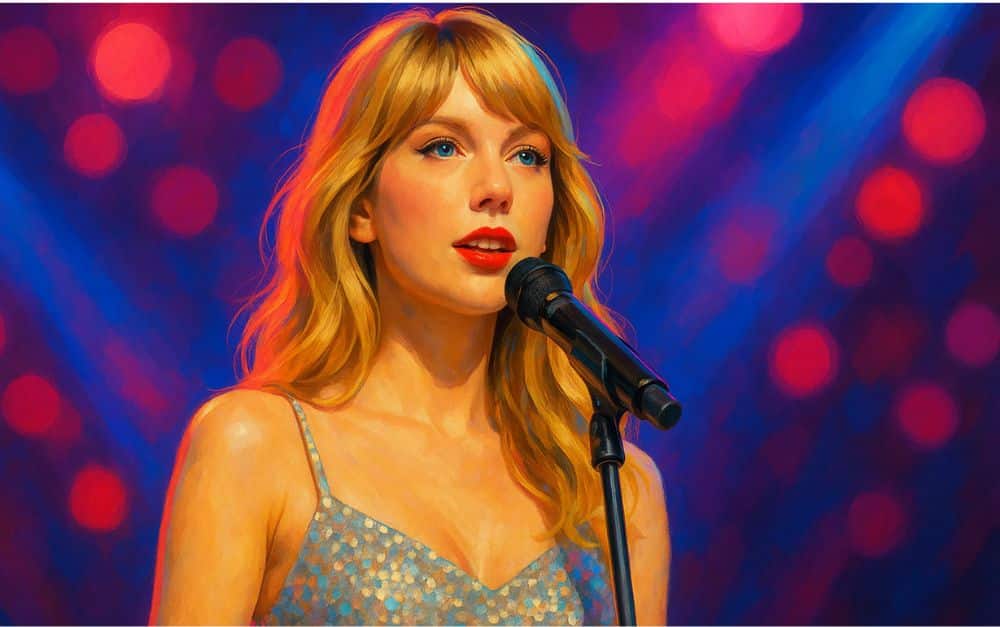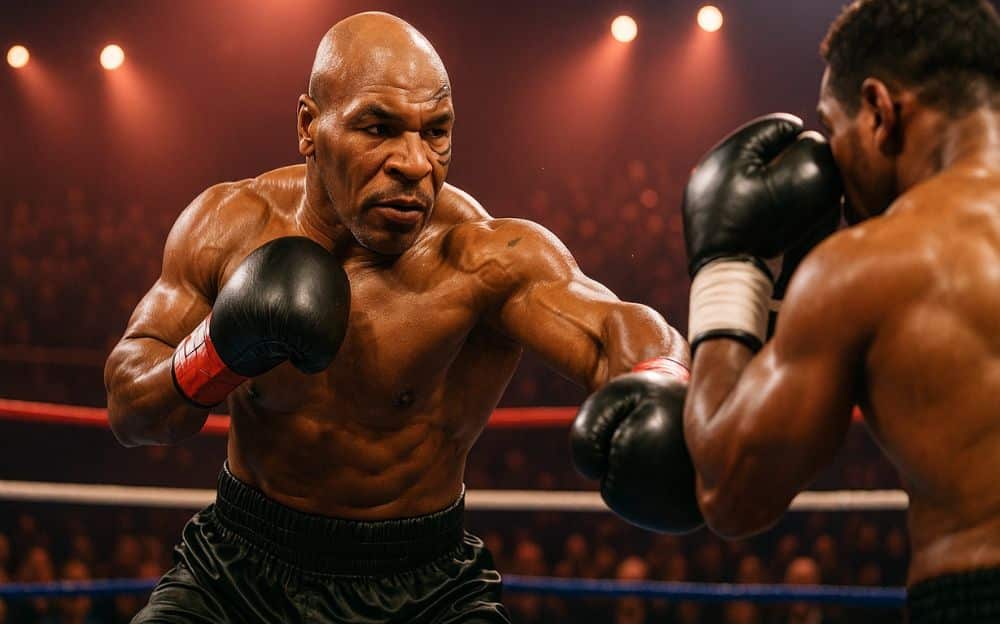Felix Stein wollte ursprünglich über bäuerliche Gemeinschaften in Südamerika promovieren. Doch hohe Studienschulden führten ihn 2011 in die Welt der Unternehmensberatung. Zwei Jahre lang arbeitete er bei einer internationalen Beratungsgesellschaft, verdiente ein Vielfaches des Durchschnittseinkommens – und gewann Einblicke, die seine Doktorarbeit Work, Sleep, Repeat prägten. Im Interview spricht er über den Beratungsmarkt, PowerPoint, die Finanzkrise und den Zusammenhang mit dem Neoliberalismus.
1. Einstieg in die Beratungsbranche
Statt nach Bolivien zu reisen, landete Stein bei einer großen Beratungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. In kurzer Zeit konnte er seine Schulden tilgen und erlebte hautnah, wie Beratungsarbeit funktioniert. Parallel entstand die Grundlage für sein Buch, das sich kritisch mit der Kultur und Logik dieser Branche auseinandersetzt.
2. Die Rolle der großen Beratungsfirmen
Namen wie McKinsey, BCG, Deloitte oder Roland Berger dominieren den Markt.
Laut Bundesverband Deutscher Unternehmensberater wächst dieser jährlich um rund 7 Prozent und setzt mehr als 29 Milliarden Euro in Deutschland um – deutlich mehr als etwa mit Alkohol verkauft wird. Berater genießen Macht, sind aber bei Angestellten oft unbeliebt, weil sie als verlängerter Arm des Managements auftreten.
3. Warum wir trotz Technik nicht weniger arbeiten
Unternehmensberater stellen stets den Vergleich zwischen „Ist-Zustand“ und „Potenzial“ an. Jede Firma könne besser, effizienter und profitabler sein – das sei der Kern ihrer Logik. Diese ständige Suche nach Optimierung erzeugt nicht weniger, sondern immer neue Arbeit. Selbst moderne Maschinen führen daher nicht zu mehr Freizeit, sondern zu höheren Anforderungen.
4. PowerPoint als zentrales Werkzeug
Präsentationen gelten als unverzichtbares Kommunikationsmittel.
Laut Stein funktionieren Folien wie Comics: wenige Informationen, viele Interpretationsmöglichkeiten. Sie wirken klar und harmonisch, verschleiern aber oft die Details. Junge Berater verbringen große Teile ihrer Zeit damit, Symbole, Pfeile und Layouts zu perfektionieren – ein rhetorisches Instrument, das Wissen suggeriert, ohne es wirklich zu liefern.
5. Beratung und Finanzkrisen
Schon in den 1930er Jahren halfen Consultants Banken, insolvente Unternehmen wieder attraktiv zu machen. Auch die Krise von 2008 zeigt: Beratung ist eng mit der Finanzialisierung verbunden – also mit der wachsenden Dominanz des Finanzsektors über Produktion und Wirtschaft. Berater vermitteln zwischen Management und Finanzwelt, wodurch ihre Rolle dauerhaft gesichert bleibt.
6. Menschenzentrierung oder nur Fassade?
Viele Beratungen sprechen heute von „menschenzentriertem“ Arbeiten.
Mitarbeitende sollen sich im Job selbst verwirklichen, während sie zugleich als austauschbare Ressourcen behandelt werden. Auch Berater selbst müssen sich ständig neu beweisen und bleiben von Projekt zu Projekt abhängig. Diese Spannung zwischen Wertschätzung und Reduktion prägt die gesamte Branche.
7. Beratung für Regierungen
Firmen wie Roland Berger wirkten maßgeblich an den Hartz-IV-Reformen mit.
Wird Politik als Management verstanden, kann das Effizienz bringen – birgt aber Risiken. Probleme erscheinen als technische Aufgaben statt als politische Konflikte. Dadurch setzt sich oft eine marktorientierte Sichtweise durch, die soziale Fragen verdrängt.
8. Zusammenhang mit Neoliberalismus
Neoliberales Denken bedeutet, dass der Staat sich zurückzieht und Bürgerinnen sich stärker ökonomisch definieren. Berater fördern diesen Ansatz, indem sie Arbeit als Ort der Selbstverwirklichung darstellen und Menschen zugleich funktionalisieren. Stein betont jedoch, dass Beratung nicht nur im Neoliberalismus, sondern in allen kapitalistischen Systemen eine Rolle spielt – theoretisch auch in einem sozialistischen.
9. Manager, Meister und Herren
Der Ethnologe Gerd Spittler unterscheidet zwischen verschiedenen Formen von Autorität: Herren herrschen ohne eigene Arbeit, Meister legitimieren sich durch Fachwissen, Manager durch Entscheidungen ohne Fachkenntnis. Berater bewegen sich in diesem Spannungsfeld – mit oft begrenztem Bezug zur tatsächlichen Produktion.
10. Zwischen Heilsbringer und Hochstapler
Berater schaffen einerseits neue Jobs, andererseits können sie auch Massenentlassungen begleiten. Ihre Arbeit folgt keinem klaren moralischen Kompass, sondern den Bedürfnissen des Marktes. Dieser Pragmatismus wird von manchen als Stärke, von anderen als Nihilismus gedeutet.
11. Persönliche Veränderung
Stein beschreibt, wie ihn die Beratungszeit selbst geprägt hat: Ungeduld, Fokus auf Effizienz und die ständige Bewertung von Zeit in Projekten. Sein Bruder, ein Philosoph, brachte es auf den Punkt: Man beginnt, Zeit nur noch in ihrer Begrenztheit zu sehen – immer getrieben von Utopien, die den nächsten Meilenstein versprechen.