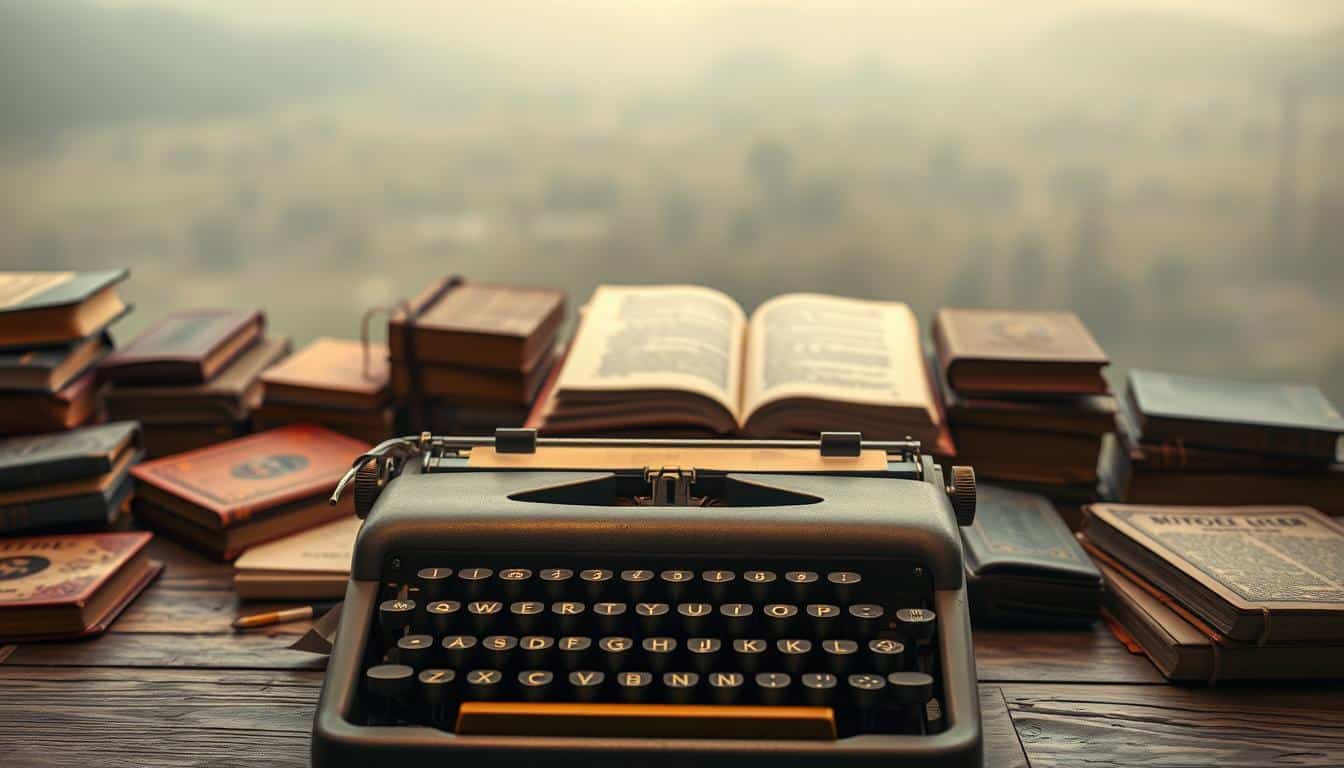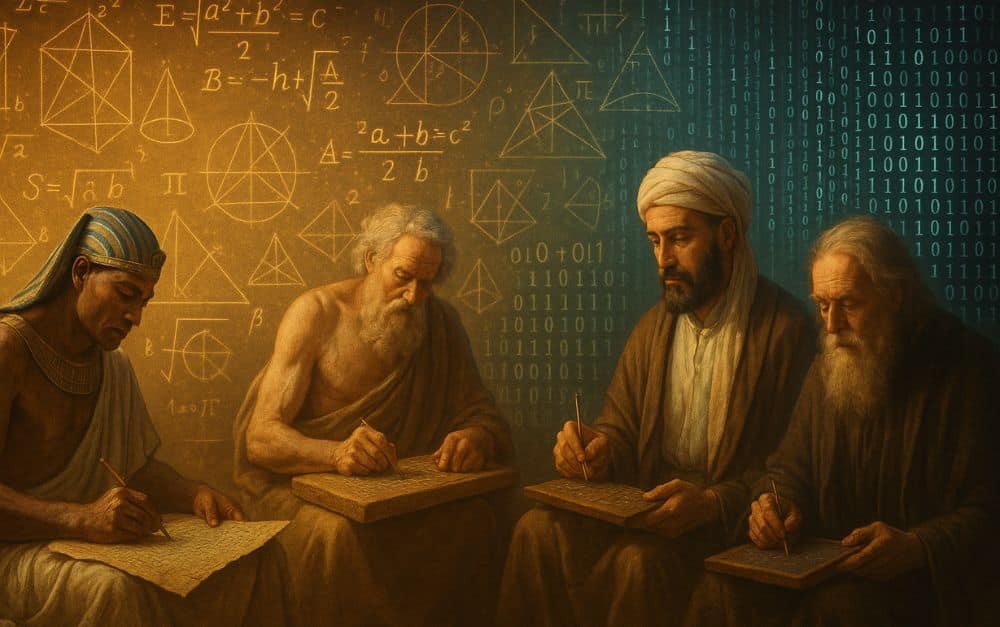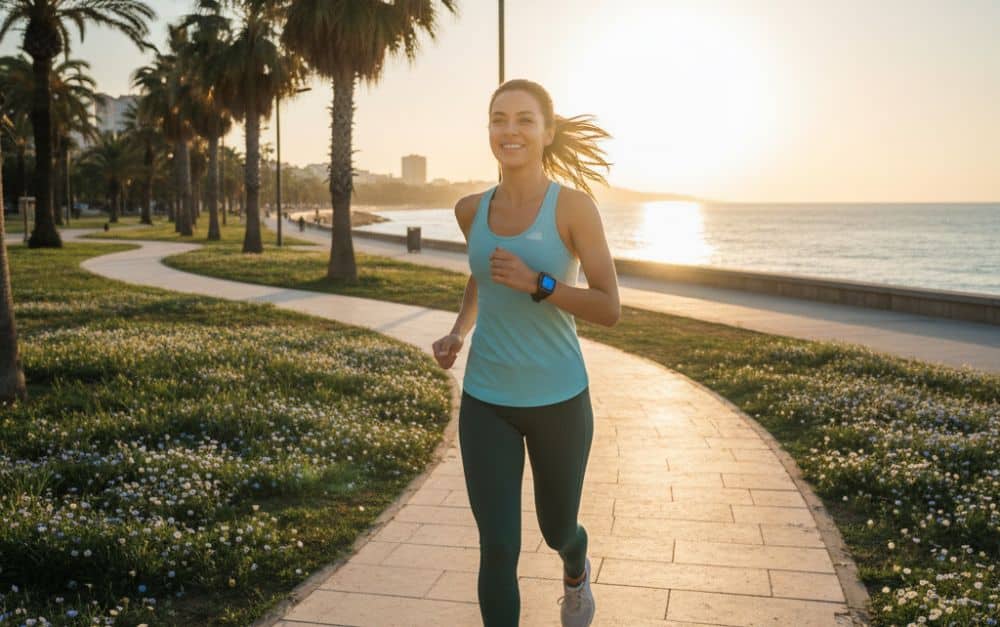Obwohl Drogen offiziell verboten sind, gehören sie seit Jahrzehnten zur Berliner Clubkultur. In vielen Clubs werden Konsum und Handel zumindest stillschweigend toleriert – nicht nur von den Veranstaltenden, sondern häufig auch von der Polizei. Warum ist das so? Diese Reportage zeichnet ein Bild der Praxis zwischen Türkontrollen, Dealern, Polizeieinsätzen und rechtlichen Grauzonen.
1. Taschenkontrollen und ungeschriebene Regeln
Schon am Eingang zeigt sich, dass es eine Art „Katz-und-Maus-Spiel“ gibt. Türsteher durchsuchen Taschen, greifen aber meist nur bei offenen Regelverstößen durch. Kleine Mengen Drogen führen selten zum Hausverbot – oft reicht ein Hinweis, das Zeug besser zu verstecken. Wer allerdings auffällig konsumiert, etwa sichtbar an der Bar, wird nach Hause geschickt. Im Schutz der Toiletten oder in stillen Ecken wird der Konsum dagegen meist geduldet, solange keine Gefahr für andere entsteht. Beim Dealen reagieren die Clubs strenger: Wer beim Anbieten von Substanzen erwischt wird, riskiert Hausverbot, jedoch selten eine Anzeige.
2. Die unsichtbaren Dealer
Neben den Gästen gibt es auch feste Clubdealer, die diskret und mit einer Art stillschweigendem Einverständnis agieren. Manche Betreiber sehen sogar Vorteile: ein verlässlicher Ansprechpartner für die Szene, bessere Qualitätssicherung und weniger chaotischer Straßenhandel im Club. Dealer wie „Oscar“ verkaufen gezielt Partydrogen wie Ecstasy oder MDMA. Sie achten darauf, die Qualität vorher zu prüfen, warnen teilweise vor zu starken Pillen und sehen sich als Teil der Clubstruktur. Für Betreiber bedeutet das: Die Gäste bleiben länger, konsumieren Getränke und die Kontrolle über die Substanzqualität ist höher. Dennoch gilt: Zu offensives Dealen wird nicht geduldet – es droht ein befristetes Hausverbot.
3. Polizei und Razzien
Offene Drogennotfälle können Clubs gefährden. Kommt es zu vielen Rettungseinsätzen, riskieren Betreiber eine polizeiliche Durchsuchung oder gar den Entzug der Konzession. Razzien verlaufen meist spektakulär: Licht an, Musik aus, Hundestaffeln und Ausweiskontrollen. Berühmt ist etwa die Aktion 2003 im Tresor, als die Polizei einen Hinweis auf einen angeblichen „Drogenbunker“ erhielt – gefunden wurde fast nichts. Solche Einsätze sind heute selten. Laut Berliner Polizei liegt das an rechtlichen Hürden und dem Fokus auf organisierte Kriminalität, nicht auf einzelne Gäste. In manchen Fällen kooperieren Clubs sogar direkt mit den Behörden, wenn sich Dealer nicht kontrollieren lassen. Zivile Ermittler spielen dabei jedoch nur eine Nebenrolle – meist wird erst auf konkrete Hinweise reagiert.
4. Zwischen Repression und Pragmatismus
Die harte Anti-Drogen-Politik der 1990er Jahre ist heute einer stillen Form von Duldung gewichen. Solange der Handel nicht zu offen geschieht, schauen Polizei und Behörden oft weg. Für die Gäste bedeutet das: Der Stoff bleibt Teil der Clubnacht, die Betreiber behalten ihr Publikum und Berlin seinen Ruf als weltoffene Partystadt. Der Nachteil: Da Substanzen auf dem Schwarzmarkt gehandelt werden, bleibt unklar, was wirklich in Pulver oder Pillen enthalten ist.
Analysen zeigen, dass viele Proben mit gefährlichen Zusatzstoffen gestreckt sind. Forderungen nach Drug-Checking oder staatlich regulierter Abgabe stoßen bislang jedoch an gesetzliche Grenzen. Selbst Aufklärungsprojekte werden in manchen Clubs nicht zugelassen – aus Angst, offen einzugestehen, dass dort Drogen im Umlauf sind.
Eine Nacht in Berlin
Am Ende einer langen Partynacht verschwimmen Euphorie, Verbundenheit und Realität. Gespräche unter Freunden, das Gefühl von Nähe und die Wirkung der Substanzen machen die Erfahrung einzigartig – auch wenn nicht immer das gekauft wird, was man erwartet hat. Trotz aller Risiken sind Drogen fester Bestandteil der Berliner Clubkultur. Zwischen Duldung, Verdrängung und punktueller Repression hat sich ein fragiles Gleichgewicht entwickelt, das allen Beteiligten nutzt – solange niemand zu sehr auffällt.